Projekt Homepage > Projektphase 1997-1999 > Teilprojekt A 8: Religiöse Netzwerke
Ethnisch und linguistisch unabhängige Grundprinzipien bei der Entstehung
religiöser Netzwerke
Auf ihrem Migrationsweg führten die einwandernden Familienverbände oder
deren Pioniere bereits die Kultobjekte mit sich, die für die individuelle
oder häusliche Protektion sorgten und mobil waren. Die eigentlich wichtigen
Kultobjekte blieben jedoch - häufig bis zum heutigen Tag - am Hauptort
der betreffenden Lineage. Grund hierfür ist die Verflechtung von Ahnenverehrung
und der Auffassung der Belebtheit der Erde, auf der die Ahnen siedelten.
So entstand von Anfang an, d.h. vom Moment der Abspaltung einer Gruppe
von ihrer Basis an, ein Bewußtsein eines rituellen Zentrums, und zwar
umso deutlicher, je mehr man sich von diesem entfernte.
Im Verlauf der Migration begegnete man natürlichen Phänomenen wie Wasserläufen,
Hügeln, Höhlen usw., denen in der Kosmologie aller am Besiedlungsprozess
des Südwestens beteiligten Gruppen herausragend spirituelle Kräfte beigemessen
werden. Jedesmal, wenn ein Fluß überquert oder ein Hügel passiert werden
mußte, trat nun ein Grundprinzip in Kraft, das ebenfalls ethnisch übergreifend
zu sein scheint: Es ist nicht möglich, mit einem mitgeführten spirituell
aufgeladenen Objekt im Gepäck ein anderes Objekt dieser Art - sei es natürlich
oder artifiziell - zu passieren, ohne eine wie auch immer geartete rituelle
Kommunikation herzustellen, also z.B. einen Schwur zu leisten, eine Opferhandlung
zu vollziehen oder ähnliches. Das Wissen über diese Versprechungen und
Opferverpflichtungen wurde an die folgenden Generationen weitergegeben,
da nur auf diese Art und Weise der religiöse Schutz der Gruppe gewährleistet
blieb. In der Notwendigkeit für die nachfolgenden Generationen, dieses
Andenken zu bewahren, begründet sich die Entstehung von Kulten, die an
natürliche Phänomene gebunden sind und periodisch praktiziert werden,
und damit auch die Entstehung von Pilgerrouten im Raum.
Schließlich traf man - wie die oralen Traditionen belegen - in den meisten
Fällen nicht etwa auf einen unbewohnten Busch, sondern auf bereits von
anderen Gruppen rituell verwaltetes Land sowie auf deren darauf installierte
Kultobjekte. Auch in dieser Situation kommt das zuvor erwähnte und in
der Regel von beiden Seiten akzeptierte Prinzip ins Spiel: Es mußte ein
rituelles Arrangement zwischen den jetzt lokal vorhandenen, aus verschiedenen
Quellen stammenden religiösen Entitäten getroffen werden. Durch diese
Assoziation der mitgebrachten mit bereits vorhandenen Vorstellungen und
Praktiken entstanden Kooperationsformen, die institutionellen Charakter
annahmen, da ihr Fortbestand über die Zeit garantiert werden mußte. Ein
häufig anzutreffendes Beispiel hierfür sind die verstreuten heiligen Orte
von Erstsiedlern, die in der Folge in den Bereich des Erdschreins einer
neu hinzukommenden Gruppe fielen.
Wir haben es also im gesamten Besiedlungsprozess mit vier Grundphänomenen
zu tun:
| mit der Entstehung
eines zentralen rituellen Bezugspunktes an den Klan- und Gründerschreinen
am ursprünglichen Siedlungsort als religiöse Repräsentation der Klangemeinschaft.
Dabei ergibt sich die eigentlich paradoxe Situation, daß dieses Zentrum
für die Weggegangenen allmählich zur Peripherie wird - zu einem "center
out there" (Turner 1973) -,
eine Peripherie jedoch, der man sich bis heute bei schwerwiegenden
spirituellen Aufgaben verpflichtet fühlt, und die man dazu regelmäßig
zu besuchen hat |
| mit der Entstehung
heiliger Orte entlang der Wegstrecke der Pioniere, der religiösen
Besetzung des Raumes also und der Vergegenwärtigung seiner Erschließung |
| mit der Herausbildung
religiös-institutionalisierter Formen der Interaktion zwischen Gruppen
von "Erstsiedlern" und "Späterkommenden" gleicher oder unterschiedlicher
ethnischer Zugehörigkeit |
| mit der Entstehung
von interethnischen Allianzen und ihrer Befestigung über die Zeit
hinweg auf der Grundlage religiöser Netzwerke |
Ein weiteres offenbar allgemeingültiges Prinzip kann hinzugefügt werden:
Uns wurde in keinem der Interviews gesagt oder angedeutet, daß das Aufeinandertreffen
von unterschiedlichen spirituellen Praktiken oder Objekten unterschiedlicher
Akteure zu einer destruktiven Auseinandersetzung geführt hätte. Grundregel
ist vielmehr der gegenseitge Respekt der religiösen Praktiken. So müssen
Opfertiere auch mit zufällig Hinzukommenden geteilt werden, und grundsätzlich
werden Kultorte respektiert. Im schlimmsten Falle herrscht Mißtrauen oder
Angst vor, und man geht sich mit seinen Praktiken buchstäblich aus dem
Weg. Dadurch kam es immer wieder zur Verlagerung bzw. zu einer Spaltung
von Kultorten. Ganz besonders gilt dieser gegenseitige Respekt für die
eigentlich esoterischen Abschnitte von Initiationskulten.
Kulthandlungen und -objekte scheinen also im Zusammenspiel der beteiligten
Gruppen von allen gleichermaßen respektiert worden zu sein. Das kann auch
darauf zurückgeführt werden, daß man es mit ähnlichen, von allen gleichermaßen
geachteten und gefürchteten spirituellen Kräften zu tun hat, deren Emanationen
Nichteingeweihte meist nicht einmal sehen dürfen. Es sei hinzugefügt,
daß die katholische Kirche offenbar der bislang einzige mobile Kult war,
der diese Prinzipien grob mißachtet hat.
Die Herausbildung der religiösen Netzwerke im Zuge der Ansiedlung von
Dagara, Birifor, Lobi, Dyan und anderen im Südwesten Burkina Fasos spielte
sich schrittweise ab und läßt sich analytisch auf vier Ebenen betrachten.
Dabei soll aber keine historische Zwangsläufigkeit im
Sinne eines evolutionistischen Schemas unterstellt werden. Die Herausbildung
von Wegesystemen im Raum auf der Grundlage des religiös motivierten Aufsuchens
von Herkunftsorten oder heiligen Stätten beispielsweise führt nicht zwangsläufig
zu einer größeren kollektiven Institutionalisierung; dieses Wegesystem
kann durchaus auf einzelne Familien beschränkt bleiben. Das zentrale Argument,
das unser Modell veranschaulichen soll, besagt aber, daß sich in keinem
der untersuchten Fälle eine bestimmte Ebene des Gesamtsystems etablieren
konnte, ohne daß die jeweils darunter liegenden Ebenen bereits vorhanden
gewesen wären.
Klicken Sie hier, um sich das Modell anzusehen...
Auch soll die Anordnung der Ebenen im Modell nicht suggerieren, die jeweils
höhere Ebene sei auch die im Bewußtsein der Akteure wichtigere. Es ist
vielmehr umgekehrt: Die im Bild zuunterst liegende Ebene der Verehrung
der Erde und der Ahnen kommt in der Hierarchie der religiösen Institutionen
eine beherrschende Stellung zu, und zwar unabhängig davon, ob die Befragten
Dagara, Pwo oder Birifor waren, oder ob es sich um Birifor handelte, die
nur in den Djoro oder zugleich in den Djoro und den Baghr der Dagara initiiert
waren. Die modellhafte Darstellung gibt also nicht die Hierarchie der
Ebenen religiöser Netzwerke wieder, sondern deren Überlagerungen. Die
Untersuchung religiöser Netzwerke, so hat sich gezeigt, muß bei der Analyse
der Interaktionen auf der obersten, zunächst sichtbaren Ebene ansetzen,
und sich dann zu den darunter liegenden Schichten "vorarbeiten".
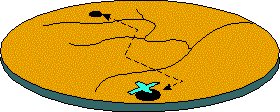 Auf
der ersten Ebene entsteht die dauerhafte Beziehung zum verwandtschaftlichen
Ursprung, d.h. die Konsolidierung von Gemeinschaft über Raum und Zeit.
Die auf dieser Ebene praktizierten Kulthandlungen beziehen sich auf die
Ahnen, auf die großen Familienfetische und auf die Erde als lebensstiftendes
Prinzip. Opferhandlungen an den Ursprungsorten finden aufgrund familiärer
oder auch individueller Probleme statt (Kindersterblichkeit, Notlagen,
Unfruchtbarkeit von Frauen etc.), und werden in Form und Umfang von Wahrsagern
am Wohnort der Betreffenden vorgeschrieben. In der Regel ist diese "therapeutische
Pilgerreise" (Rivière 1995) an die
Herkunftsorte jeweils zweimal nötig, nämlich einmal zur Kontaktierung
der Ahnen und der Erde und zum Aussprechen des Anliegens und ein zweites
Mal - sofern sich die Situation daraufhin zum Besseren gewendet hat -
zur Danksagung in Form erneuter Opfergaben. Tritt keine Besserung ein,
muß der Vorgang entsprechend wiederholt werden.
Auf
der ersten Ebene entsteht die dauerhafte Beziehung zum verwandtschaftlichen
Ursprung, d.h. die Konsolidierung von Gemeinschaft über Raum und Zeit.
Die auf dieser Ebene praktizierten Kulthandlungen beziehen sich auf die
Ahnen, auf die großen Familienfetische und auf die Erde als lebensstiftendes
Prinzip. Opferhandlungen an den Ursprungsorten finden aufgrund familiärer
oder auch individueller Probleme statt (Kindersterblichkeit, Notlagen,
Unfruchtbarkeit von Frauen etc.), und werden in Form und Umfang von Wahrsagern
am Wohnort der Betreffenden vorgeschrieben. In der Regel ist diese "therapeutische
Pilgerreise" (Rivière 1995) an die
Herkunftsorte jeweils zweimal nötig, nämlich einmal zur Kontaktierung
der Ahnen und der Erde und zum Aussprechen des Anliegens und ein zweites
Mal - sofern sich die Situation daraufhin zum Besseren gewendet hat -
zur Danksagung in Form erneuter Opfergaben. Tritt keine Besserung ein,
muß der Vorgang entsprechend wiederholt werden.
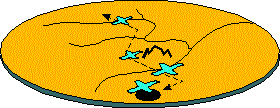 Das
zweite Niveau religiöser Netzwerke bildet sich mit der Ausdehnung der
Gruppe im Raum heraus. Es entstehen heilige Orte der Verehrung natürlicher
Phänomene, Pilgerrouten und Initiationswege. Nachfolgende Generationen
müssen zu diesen Orten zurückkehren, um den spirituellen Kräften für die
Erfüllung der Wünsche zu danken, die die Ahnen bei ihrem Überqueren ausgesprochen
hatten. Auf dieser Ebene stattfindende religiöse Handlungen können, wie
bei der ersten Ebene, individuell-therapeutischer Natur sein; meist entwickeln
sich hier aber schon kollektive Formen der rituellen Vergegenwärtigung
der Gemeinschaft im Raum, die sich in Form regelrechter Pilgerrouten verfestigen
können. Differenziert sich eine Lineage an den jüngeren Siedlungsorten
weiter aus und migrieren einzelne Familien von dort aus weiter, so kann
sich das gesamte Bezugssystem auf den beiden unteren Ebenen zu neueren
Siedlungsorten hin verlagern. An die Stelle der ursprünglichen Orte des
übergeordneten Klans treten dann als neue zentrale Bezugspunkte die Orte,
von denen aus eine weiterführende Abspaltung einzelner Familien erfolgte.
An dem im Modell dargestellten Muster ändert sich dabei nichts, wohl aber
an der Position des gesamten Netzwerkes im Raum.
Das
zweite Niveau religiöser Netzwerke bildet sich mit der Ausdehnung der
Gruppe im Raum heraus. Es entstehen heilige Orte der Verehrung natürlicher
Phänomene, Pilgerrouten und Initiationswege. Nachfolgende Generationen
müssen zu diesen Orten zurückkehren, um den spirituellen Kräften für die
Erfüllung der Wünsche zu danken, die die Ahnen bei ihrem Überqueren ausgesprochen
hatten. Auf dieser Ebene stattfindende religiöse Handlungen können, wie
bei der ersten Ebene, individuell-therapeutischer Natur sein; meist entwickeln
sich hier aber schon kollektive Formen der rituellen Vergegenwärtigung
der Gemeinschaft im Raum, die sich in Form regelrechter Pilgerrouten verfestigen
können. Differenziert sich eine Lineage an den jüngeren Siedlungsorten
weiter aus und migrieren einzelne Familien von dort aus weiter, so kann
sich das gesamte Bezugssystem auf den beiden unteren Ebenen zu neueren
Siedlungsorten hin verlagern. An die Stelle der ursprünglichen Orte des
übergeordneten Klans treten dann als neue zentrale Bezugspunkte die Orte,
von denen aus eine weiterführende Abspaltung einzelner Familien erfolgte.
An dem im Modell dargestellten Muster ändert sich dabei nichts, wohl aber
an der Position des gesamten Netzwerkes im Raum.
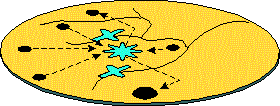 Auf
dem dritten Niveau kommt es zur Entstehung und Regulierung von institutionalisierten
Kulten und Wechselbeziehungen zwischen Kollektiven. Bestehende Pilgerrouten
und heilige Orte werden in größere rituelle Topographien eingegliedert.
Durch partielles Delegieren ritueller Aufgaben entstehen wechselseitige
Abhängigkeiten und Hierarchien. Die religiösen Praktiken sind jetzt mit
dem Fortbestand größerer Kollektive verbunden und spielen sich im Rahmen
umfangreicher Protokolle periodisch stattfindender Initiationen ab. Es
zeigen sich im Vergleich der Initiationen im Südwesten Burkina Fasos hier
durchaus große Unterschiede in der Bedeutung von rituellen Wegen und Orten
und in der Art und Verbindlichkeit der Protokolle und der Periodizität.
Die integrative, identitäts- und lebensstiftende Funktion der religiösen
Institutionen auf dieser Ebene, ihre gruppenübergreifende Anziehungskraft
und der Bezug zu den beiden darunterliegenden Ebenen sind jedoch bei allen
Gruppen gleich.
Auf
dem dritten Niveau kommt es zur Entstehung und Regulierung von institutionalisierten
Kulten und Wechselbeziehungen zwischen Kollektiven. Bestehende Pilgerrouten
und heilige Orte werden in größere rituelle Topographien eingegliedert.
Durch partielles Delegieren ritueller Aufgaben entstehen wechselseitige
Abhängigkeiten und Hierarchien. Die religiösen Praktiken sind jetzt mit
dem Fortbestand größerer Kollektive verbunden und spielen sich im Rahmen
umfangreicher Protokolle periodisch stattfindender Initiationen ab. Es
zeigen sich im Vergleich der Initiationen im Südwesten Burkina Fasos hier
durchaus große Unterschiede in der Bedeutung von rituellen Wegen und Orten
und in der Art und Verbindlichkeit der Protokolle und der Periodizität.
Die integrative, identitäts- und lebensstiftende Funktion der religiösen
Institutionen auf dieser Ebene, ihre gruppenübergreifende Anziehungskraft
und der Bezug zu den beiden darunterliegenden Ebenen sind jedoch bei allen
Gruppen gleich.
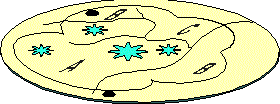 Auf
dem vierten Niveau schließlich - das für den von außen kommenden Betrachter
das zunächst beobachtbare ist - wirken die Allianzen auf der Grundlage
religiöser Netzwerke auf den historischen Gesamtzusammenhang interethnischer
Beziehungen und politischer Machtverhältnisse ein. Es entstehen weitreichende
einseitige oder gegenseitige Abhängigkeiten und außerdem ein übergeordnetes
Bezugssystem, das es den beteiligten Gruppen ermöglicht, divergierende
Weltbilder und kulturelle Unterschiede gegenseitig zu respektieren.
Auf
dem vierten Niveau schließlich - das für den von außen kommenden Betrachter
das zunächst beobachtbare ist - wirken die Allianzen auf der Grundlage
religiöser Netzwerke auf den historischen Gesamtzusammenhang interethnischer
Beziehungen und politischer Machtverhältnisse ein. Es entstehen weitreichende
einseitige oder gegenseitige Abhängigkeiten und außerdem ein übergeordnetes
Bezugssystem, das es den beteiligten Gruppen ermöglicht, divergierende
Weltbilder und kulturelle Unterschiede gegenseitig zu respektieren.
Die Handlungsspielräume und die Problemlösungsmöglichkeiten für einzelne
Akteure oder Gruppen sind um so größer, je vielschichtiger ihre Einbindung
in das religiöse Netzwerk organisiert ist. Dies läßt sich in der Darstellung
vom Standpunkt eines fiktiven Informanten X der Ethnie B aus nachvollziehen.
Seine Vorfahren überquerten, von der ghanaischen Seite aus kommend, den
Volta und opferten am Ort der Flußüberquerung, installierten auf ihrem
Weg kleinere Kultorte an Nebenflüssen des Bougouriba, schlossen sich auf
ihrer Station in der Gegend von Nako einem größeren Initiationskult an,
und ließen sich schließlich am Wohnort des Informanten nieder, wo bereits
andere Familien der Ethnien A, B und C siedelten. Bei familiären Problemen
konsultiert X den Wahrsager seines Klans und begibt sich auf Pilgerfahrt
entlang der Route seiner Vorfahren bis ins alte Land auf der anderen Seite
des Volta. Seine Kinder läßt er durch Spezialisten der Ethnie A initiieren;
die guten nachbarschaftlichen Beziehungen mit B-Familien beruhen ebenfalls
auf der gemeinsamen Mitgliedschaft von B- und C-Klans im von A-Familien
betriebenen Initiationskult.
Es steht unterdessen nicht im Widerspruch zu den auf verschiedenen Ebenen
integrierenden, kathartischen Eigenschaften religiöser Netzwerke, daß
es in bestimmten historischen Situationen auch zur Instrumentalisierung
von Kulten für partikulare politische Interessen kam. So zeigt das folgende
Beispiel des Djoro von Nako, daß die Kultpolitik der Pwo gegenüber den
Lobi am Ende des 19. Jahrhunderts zwar zu einer dauerhaften Abhängigkeit
der letzteren von den ersteren geführt hat, zugleich aber destruktive
gewaltsame Auseinandersetzungen weitestgehend verhindert wurden. Dieser
Prozeß hat sich mit der Entstehung von Filialen des von Lobi betriebenen
Djoro im Bereich der Birifor und Dyan fortgesetzt und auch hier zu einer
weitestgehend friedlichen Koexistenz beigetragen.
Sonderforschungsbereich 268 "Kulturentwicklung und Sprachgeschichte
im Naturraum Westafrikanische Savanne", Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main. Verwendung von Texten, Bildern oder Karten (außer
für private Zwecke) nur mit schriftlicher Zustimmung der Autoren.
Kontakt: Dr. Richard Kuba, Institut für historische Ethnologie, Grüneburgplatz 1, D - 60323 Frankfurt am Main, Tel. +49-69-79833066
Web-Design von Volker Linz/Karstkunst Webdienste Berlin.
Webmistress: Julia Weinmann
Letzte Aktualisierung 05/2002. |
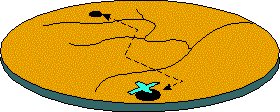 Auf
der ersten Ebene entsteht die dauerhafte Beziehung zum verwandtschaftlichen
Ursprung, d.h. die Konsolidierung von Gemeinschaft über Raum und Zeit.
Die auf dieser Ebene praktizierten Kulthandlungen beziehen sich auf die
Ahnen, auf die großen Familienfetische und auf die Erde als lebensstiftendes
Prinzip. Opferhandlungen an den Ursprungsorten finden aufgrund familiärer
oder auch individueller Probleme statt (Kindersterblichkeit, Notlagen,
Unfruchtbarkeit von Frauen etc.), und werden in Form und Umfang von Wahrsagern
am Wohnort der Betreffenden vorgeschrieben. In der Regel ist diese "therapeutische
Pilgerreise" (Rivière 1995) an die
Herkunftsorte jeweils zweimal nötig, nämlich einmal zur Kontaktierung
der Ahnen und der Erde und zum Aussprechen des Anliegens und ein zweites
Mal - sofern sich die Situation daraufhin zum Besseren gewendet hat -
zur Danksagung in Form erneuter Opfergaben. Tritt keine Besserung ein,
muß der Vorgang entsprechend wiederholt werden.
Auf
der ersten Ebene entsteht die dauerhafte Beziehung zum verwandtschaftlichen
Ursprung, d.h. die Konsolidierung von Gemeinschaft über Raum und Zeit.
Die auf dieser Ebene praktizierten Kulthandlungen beziehen sich auf die
Ahnen, auf die großen Familienfetische und auf die Erde als lebensstiftendes
Prinzip. Opferhandlungen an den Ursprungsorten finden aufgrund familiärer
oder auch individueller Probleme statt (Kindersterblichkeit, Notlagen,
Unfruchtbarkeit von Frauen etc.), und werden in Form und Umfang von Wahrsagern
am Wohnort der Betreffenden vorgeschrieben. In der Regel ist diese "therapeutische
Pilgerreise" (Rivière 1995) an die
Herkunftsorte jeweils zweimal nötig, nämlich einmal zur Kontaktierung
der Ahnen und der Erde und zum Aussprechen des Anliegens und ein zweites
Mal - sofern sich die Situation daraufhin zum Besseren gewendet hat -
zur Danksagung in Form erneuter Opfergaben. Tritt keine Besserung ein,
muß der Vorgang entsprechend wiederholt werden. 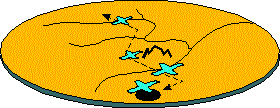 Das
zweite Niveau religiöser Netzwerke bildet sich mit der Ausdehnung der
Gruppe im Raum heraus. Es entstehen heilige Orte der Verehrung natürlicher
Phänomene, Pilgerrouten und Initiationswege. Nachfolgende Generationen
müssen zu diesen Orten zurückkehren, um den spirituellen Kräften für die
Erfüllung der Wünsche zu danken, die die Ahnen bei ihrem Überqueren ausgesprochen
hatten. Auf dieser Ebene stattfindende religiöse Handlungen können, wie
bei der ersten Ebene, individuell-therapeutischer Natur sein; meist entwickeln
sich hier aber schon kollektive Formen der rituellen Vergegenwärtigung
der Gemeinschaft im Raum, die sich in Form regelrechter Pilgerrouten verfestigen
können. Differenziert sich eine Lineage an den jüngeren Siedlungsorten
weiter aus und migrieren einzelne Familien von dort aus weiter, so kann
sich das gesamte Bezugssystem auf den beiden unteren Ebenen zu neueren
Siedlungsorten hin verlagern. An die Stelle der ursprünglichen Orte des
übergeordneten Klans treten dann als neue zentrale Bezugspunkte die Orte,
von denen aus eine weiterführende Abspaltung einzelner Familien erfolgte.
An dem im Modell dargestellten Muster ändert sich dabei nichts, wohl aber
an der Position des gesamten Netzwerkes im Raum.
Das
zweite Niveau religiöser Netzwerke bildet sich mit der Ausdehnung der
Gruppe im Raum heraus. Es entstehen heilige Orte der Verehrung natürlicher
Phänomene, Pilgerrouten und Initiationswege. Nachfolgende Generationen
müssen zu diesen Orten zurückkehren, um den spirituellen Kräften für die
Erfüllung der Wünsche zu danken, die die Ahnen bei ihrem Überqueren ausgesprochen
hatten. Auf dieser Ebene stattfindende religiöse Handlungen können, wie
bei der ersten Ebene, individuell-therapeutischer Natur sein; meist entwickeln
sich hier aber schon kollektive Formen der rituellen Vergegenwärtigung
der Gemeinschaft im Raum, die sich in Form regelrechter Pilgerrouten verfestigen
können. Differenziert sich eine Lineage an den jüngeren Siedlungsorten
weiter aus und migrieren einzelne Familien von dort aus weiter, so kann
sich das gesamte Bezugssystem auf den beiden unteren Ebenen zu neueren
Siedlungsorten hin verlagern. An die Stelle der ursprünglichen Orte des
übergeordneten Klans treten dann als neue zentrale Bezugspunkte die Orte,
von denen aus eine weiterführende Abspaltung einzelner Familien erfolgte.
An dem im Modell dargestellten Muster ändert sich dabei nichts, wohl aber
an der Position des gesamten Netzwerkes im Raum.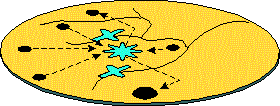 Auf
dem dritten Niveau kommt es zur Entstehung und Regulierung von institutionalisierten
Kulten und Wechselbeziehungen zwischen Kollektiven. Bestehende Pilgerrouten
und heilige Orte werden in größere rituelle Topographien eingegliedert.
Durch partielles Delegieren ritueller Aufgaben entstehen wechselseitige
Abhängigkeiten und Hierarchien. Die religiösen Praktiken sind jetzt mit
dem Fortbestand größerer Kollektive verbunden und spielen sich im Rahmen
umfangreicher Protokolle periodisch stattfindender Initiationen ab. Es
zeigen sich im Vergleich der Initiationen im Südwesten Burkina Fasos hier
durchaus große Unterschiede in der Bedeutung von rituellen Wegen und Orten
und in der Art und Verbindlichkeit der Protokolle und der Periodizität.
Die integrative, identitäts- und lebensstiftende Funktion der religiösen
Institutionen auf dieser Ebene, ihre gruppenübergreifende Anziehungskraft
und der Bezug zu den beiden darunterliegenden Ebenen sind jedoch bei allen
Gruppen gleich.
Auf
dem dritten Niveau kommt es zur Entstehung und Regulierung von institutionalisierten
Kulten und Wechselbeziehungen zwischen Kollektiven. Bestehende Pilgerrouten
und heilige Orte werden in größere rituelle Topographien eingegliedert.
Durch partielles Delegieren ritueller Aufgaben entstehen wechselseitige
Abhängigkeiten und Hierarchien. Die religiösen Praktiken sind jetzt mit
dem Fortbestand größerer Kollektive verbunden und spielen sich im Rahmen
umfangreicher Protokolle periodisch stattfindender Initiationen ab. Es
zeigen sich im Vergleich der Initiationen im Südwesten Burkina Fasos hier
durchaus große Unterschiede in der Bedeutung von rituellen Wegen und Orten
und in der Art und Verbindlichkeit der Protokolle und der Periodizität.
Die integrative, identitäts- und lebensstiftende Funktion der religiösen
Institutionen auf dieser Ebene, ihre gruppenübergreifende Anziehungskraft
und der Bezug zu den beiden darunterliegenden Ebenen sind jedoch bei allen
Gruppen gleich.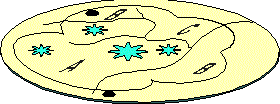 Auf
dem vierten Niveau schließlich - das für den von außen kommenden Betrachter
das zunächst beobachtbare ist - wirken die Allianzen auf der Grundlage
religiöser Netzwerke auf den historischen Gesamtzusammenhang interethnischer
Beziehungen und politischer Machtverhältnisse ein. Es entstehen weitreichende
einseitige oder gegenseitige Abhängigkeiten und außerdem ein übergeordnetes
Bezugssystem, das es den beteiligten Gruppen ermöglicht, divergierende
Weltbilder und kulturelle Unterschiede gegenseitig zu respektieren.
Auf
dem vierten Niveau schließlich - das für den von außen kommenden Betrachter
das zunächst beobachtbare ist - wirken die Allianzen auf der Grundlage
religiöser Netzwerke auf den historischen Gesamtzusammenhang interethnischer
Beziehungen und politischer Machtverhältnisse ein. Es entstehen weitreichende
einseitige oder gegenseitige Abhängigkeiten und außerdem ein übergeordnetes
Bezugssystem, das es den beteiligten Gruppen ermöglicht, divergierende
Weltbilder und kulturelle Unterschiede gegenseitig zu respektieren.